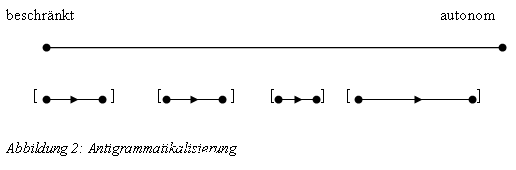In Anlehnung an Lehmann (vgl. u.a. 2002; 2004) soll Grammatikalisierung als ein gradueller Sprachwandelprozess verstanden werden, durch den ein sprachliches Zeichen allmählich an Autonomie verliert. Grammatikalisierung eines sprachlichen Elements heißt demnach vor allem Verfestigung, d. h. Unterwerfung unter Beschränkungen des Sprachsystems. Die Definition unter D1 ist unseren folgenden Überlegungen zugrunde zu legen.
| D1: "Grammaticalization of a linguistic sign is a process in which it loses in autonomy by becoming more subject to constraints of the linguistic system" (Lehmann 2004: 3). |
Der unter D1 beschriebene Sprachwandelprozess kann folgendermaßen graphisch dargestellt werden:
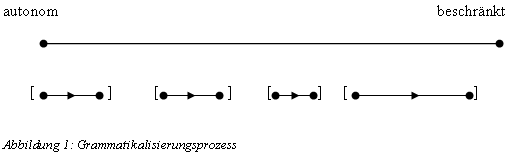
Die eckigen Klammern repräsentieren einen Zeitraum, der von einem früheren historischen Stadium einer Sprache (L1) zu einem späteren Stadium (L2) führt. Innerhalb dieses Zeitraums findet ein Prozess statt, der eine sprachliche Form F1 des Stadiums L1 (linker Punkt) in eine sprachliche Form F2 des Stadiums L2 (rechter Punkt) transformiert. Wichtig ist auch, dass zwischen F1 und F2 trotz der Transformation diachronische Identität bestehen bleibt (vgl. Lehmann 2004: 4-6). Die vollzogene Transformation ist derart, dass F1 autonomer ist als F2 (dies wird durch die Pfeile symbolisiert).
Die verschiedenen Einheiten bestehend aus Klammern, Punkten und Pfeilen stehen an unterschiedlichen Stellen des Kontinuums autonom – beschränkt. Dies soll auf die Tatsache hindeuten, dass D1 sich nicht nur auf die (prototypische) Entwicklung bezieht, die als Ausgangsform (F1) ein Volllexem hat, sondern auch auf jene, die eine Ausgangsform mit einem bereits relativ hohen Grammatikalitätsgrad (und konsequenterweise mit einer relativ niedrigen Autonomie) in eine andere (F2) verändert, die über einen noch höheren Grammatikalitätsgrad verfügt. Diese Bemerkung ist in unserem Zusammenhang daher wichtig, weil eine Erklärung der Irreversibilität auch für Fälle des letztgenannten Typs adäquat und plausibel sein muss.
Die Untersuchung von Grammatikalisierungsprozessen ist nicht möglich ohne ein gewisses Maß an Abstraktion. Es scheint vor allem methodologisch unumgänglich zu sein, die Prozesse zu temporalisieren, also ein Vorher in der Form eines L1-F1 und ein Nachher in der Form eines L2-F2 zu determinieren und diese dann miteinander zu vergleichen. Die verschiedenen Längen der Einheiten in der Abbildung (1) sollen darauf aufmerksam machen, dass wir stets unterschiedliche, alternative Möglichkeiten der Temporalisierung eines komplexen Grammatikalisierungsprozesses haben. Wir können beispielsweise als F1 das deiktische Pronomen der dritten Person des Lateins ille und als F2 das (diachronisch identische) Personalpronomen il des Französischen wählen. Als F2 könnten wir aber auch das neutrale anaphorische Pronomen des Vulgärlatein ille wählen. Und was in der einen Temporalisierungsmöglichkeit als F2 fungiert, kann in der anderen genauso gut als F1 fungieren. Wer sich z.B. für aktuelle Sprachwandeltendenzen des (umgangssprachlichen) Französischen interessiert, könnte il in seiner "Standardverwendung" (F1) mit il in Sätzen vergleichen, in denen ein explizit realisiertes Subjekt vorhanden ist (F2), wie etwa in Rechtsversetzungen (lui, il n’a pas d’argent).
Per Analogie zu D1 können wir Antigrammatikalisierung wie folgt definieren: